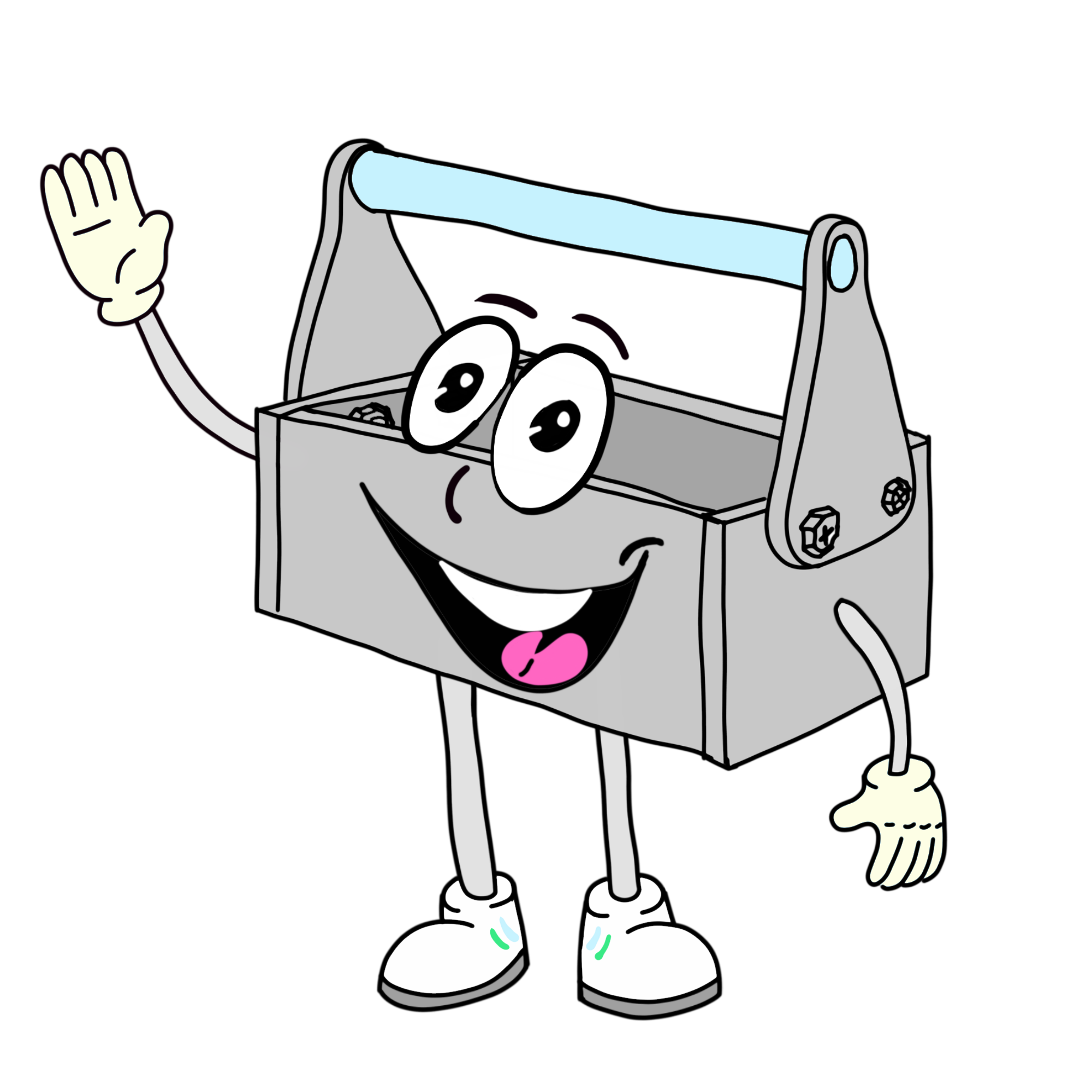Das Internetprotokoll, kurz IP, bildet die Grundlage der modernen digitalen Kommunikation und ist unverzichtbar für den Datenaustausch über das Internet. Es ermöglicht, dass Informationen in Form von Datenpaketen zwischen verschiedenen Geräten auf der ganzen Welt übertragen werden können. Ohne IP wäre die heutige vernetzte Welt, wie wir sie kennen, undenkbar.
Doch was genau steckt hinter diesem Protokoll, wie funktioniert es, und warum ist es so essenziell für unsere digitale Infrastruktur? In diesem Beitrag tauchen wir tiefer in die Welt des Internetprotokolls ein und beleuchten seine Funktionsweise, die verschiedenen Versionen sowie seine Bedeutung für die heutige Technologie.
Das IP ist ein verbindungsloses, unzuverlässiges Best-Effort-Protokoll, das Datagramme ohne Verbindungsaufbau überträgt. Best-Effort bezeichnet ein einfaches Service-Modell in IP-Netzwerken, bei dem die Infrastruktur „ihr Bestes“ gibt, Datenpakete weiterzuleiten, ohne jegliche Zusicherung. Die Vorteile sind dabei:
- Skalierbarkeit: das Netzwerk kann einfacher erweitert werden, da keine komplexe Sitzungsverwaltung erforderlich ist.
- Fexibilität: Anwendungen oder höher liegende Protokolle entscheiden ob Zuverlässigkeit bei einer Übertragung „nachgerüstet“ wird.
Es gibt zwei Versionen des IP:
- IPv4
- IPv6
Routing
Unabhängig von der Version, dient das IP der Vermittlung von Datenpaketen in Netzwerken. An Stelle des Absenders bestimmen Router entlang des Wegs anhand ihrer Routingtabellen den jeweils nächsten Hop. Dieser Vermittlungsvorgang eines Übertragungsweges wird „Routing“ genannt.
Prinzip von Routing. Quelle: Technik-Kiste.de
Es ist in Ordnung, dass die Reihenfolge des Empfangs nicht der Reihenfolge des Sendens entspricht. Der Grund hierfür sind die unterschiedlichen Wege, die gesendete Informationen nehmen können. Transportseitige (höhere) Protokolle wie TCP stellen durch Sequenznummern und Bestätigungen (ACKs) die korrekte Reihenfolge und Vollständigkeit wieder her.
Information: mehr über Routing findest du im Routing-Beitrag (Stand 06/2025 noch nicht fertig).
IP-Paket (IP-Datagramm)
Ein TCP-Segment oder UDP-Datagramm bildet die Nutzlast eines IP-Datagramms, das wiederum als Payload / Nutzlast in einen Ethernet-Frame eingefügt wird. Im TCP/IP-Modell liegt IP auf der Vermittlungsschicht (Network Layer) zwischen den Transportprotokollen (Host-to-Host Layer, z. B. TCP/UDP) und den Netzwerkschnittstellen (Link Layer, z. B. Ethernet).
Datenkapselung des Internetprotokolls innerhalb des TCP/IP-Referenzmodells. Quelle: Technik-Kiste.de
Wichtig bei der Übertragung von Daten ist der IP-Header. Der IP-Header enthält u. a. Quell- und Ziel-IP-Adresse, TTL (Time To Live), Protokollkennzeichen und Prüfsumme.
Information: mehr zu den Inhalten der Header und Protokolle selbst, findest du in den Artikeln zu IPv4 (zum Beitrag) und IPv6 (zum Beitrag).
IP-Adressen
IP-Adressen sind die logischen Adressen (Network Layer), im Gegensatz zu MAC-Adressen, den physischen Adressen auf dem Link Layer. Sie dienen der Kommunikation mit Teilnehmenden außerhalb des eigenen Netzwerks.
Ein unterstützter Host kann sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen nutzen – jede Version bringt jedoch eine fest definierte Adresslänge mit (32 Bit respektive 128 Bit).
Auch die Anzahl möglicher Adressen weltweit ist abhängig von der Version. Bei IPv4 sind es 4.294.967.296 Adressen, während IPv6 über 340 Sextillionen bzw. 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2^128) Adressen verfügt.
Die Vergabe der Adressen erfolgt durch die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) die diese an die regionalen Vergabestellen (Regional Internet Registry – RIR) vergibt. Zu den RIR zählen:
- Europa, Naher Osten, Zentralasien: RIPE NCC (Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre)
- Asien, Pazifik: APNIC (Asian Pacific Network Information Centre)
- Afrika: AfriNIC (African Network Information Centre)
- Lateinamerika, Karibik: LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry)
- Nordamerika: ARIN (American Registry for Internet Numbers)
Die RIR vergeben Adressblöcke an Local Internet Registries (LIR). Dies sind meist ISPs, große Unternehmen oder Bildungseinrichtungen. In LANs nutzt man üblicherweise die reservierten Privatnetz-Bereiche (RFC 1918 für IPv4, RFC 4193 für IPv6). Adressen werden dort meist automatisch per DHCP-Server oder manuell durch den Administrator vergeben.
Information: Mehr zu IP-Adressen findest du in den Artikeln zu IPv4 (zum Beitrag) und IPv6 (zum Beitrag).