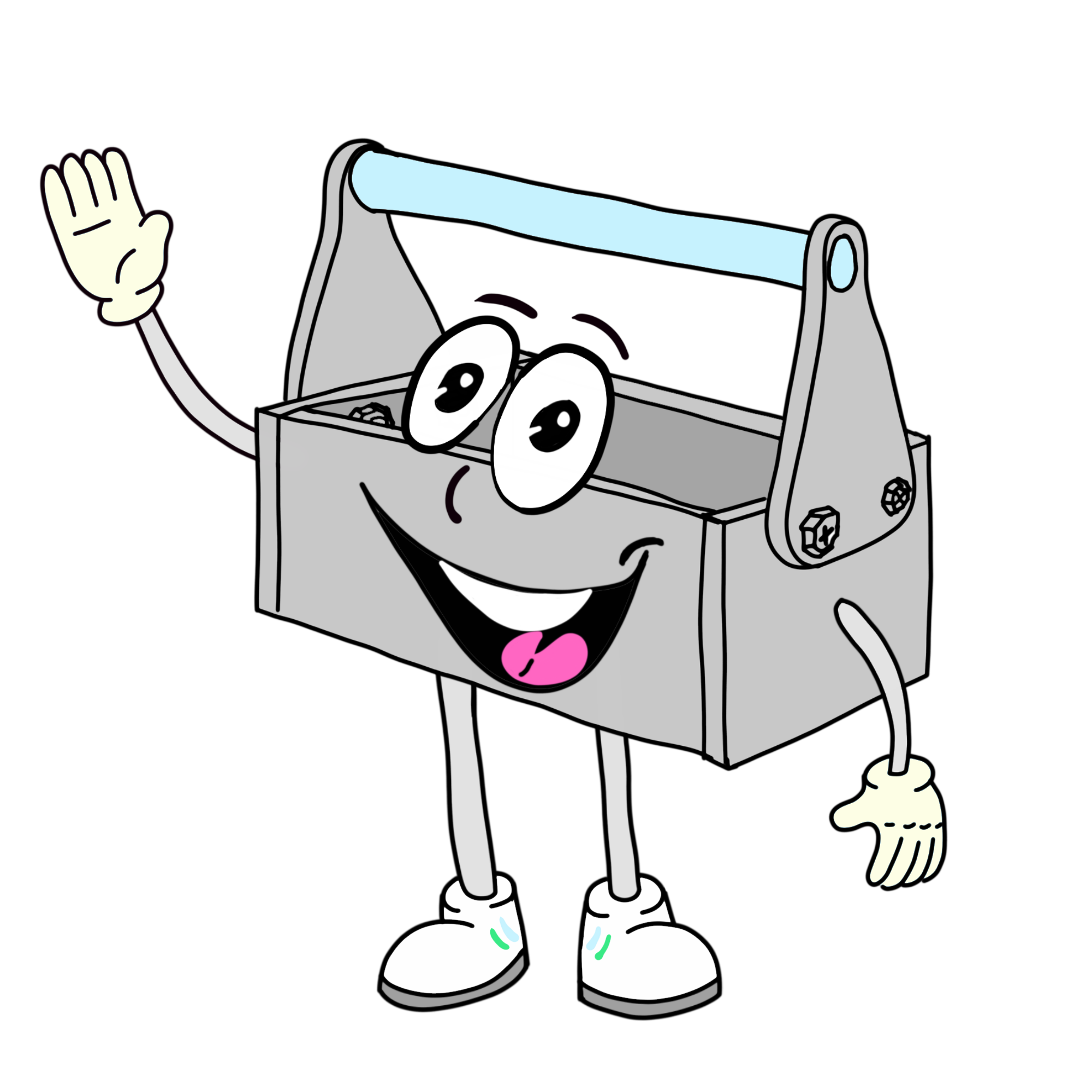Lichtwellenleiter (LWL)-Kabel sind das Rückgrat moderner Kommunikationsnetze. Sie ermöglichen eine gegenüber elektrischen Einflüssen ungestörte Übertragung großer Datenmengen – und das mit Lichtwellen statt elektrischen Signalen. Wie funktionieren sie genau, und welche Vorteile bieten sie? Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die faszinierende Welt der LWL-Technologie.
Vorteile:
- Hohe Bandbreiten möglich
- Keine elektromagnetischen Beeinflussungen
- Nicht elektrisch Potenzial führend (Ausnahme bei Kabelschirmen zum Schutz)
- Kein Übersprechen
Nachteile:
- Netzelemente müssen für Verbindungen gleichen Standard verwenden
- Unterschiedliche Steckersysteme
- Empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen
- Höhere Investitionskosten
- Nicht für jedes Netzelement / Verbindung geeignet.
Prinzip
Eine Lichtwelle wird reflektiert, wenn sie schräg von einem Medium auf ein anderes trifft.
Darstellung einer Reflexion. Quelle. Technik-Kiste.de
Dieses Prinzip lässt sich auch an der Reflexion einer Wasseroberfläche veranschaulichen: Betrachtet man das Wasser aus einem flachen Winkel, sind Objekte unterhalb der Oberfläche kaum erkennbar – erst ab einem steileren, nahezu senkrechten Blickwinkel wird ein Blick in das Wasser möglich.
Aufgrund dieses Prinzips spricht man häufig von optischen Übertragungen oder optischen Medien.
Für die Übertragung von Lichtwellen wird als lichtleitende Struktur eine Faser verwendet. Innerhalb eines jeden LWL-Kabel befinden sich ein oder mehrere Fasern, welche das Licht führen. Der Begriff „Mode“ bezeichnet hierbei den Ausbreitungsmodus des Lichts in der Faser.
Merke: Faser = lichtleitende Struktur | Mode = Ausbreitung des Lichts
Faser
Bei simplex-basierten Systemen wird eine Faser pro Übertragungsrichtung verwendet. Moderne Systeme nutzen jedoch häufig Wavelength-Division-Multiplexing (WDM), wodurch eine bidirektionale Kommunikation über eine einzelne Faser möglich ist.
Grundsätzlich ähnelt sich der Aufbau unterschiedlicher Fasertypen darin, dass sie aus einem Kern aus Glas oder glasähnlichem Kunststoff bestehen. Den Kern umgibt der Mantel (engl. Cladding).
Aufbau einer Faser. Quelle: Technik-Kiste.de
Um den Kern und den Mantel herum befindet das Primary Coating – eine Schutzbeschichtung.
Bei einem Lichtwellenleiter wird das Licht an der Grenzfläche zwischen Kern (hoher Brechungsindex) und Mantel (niedriger Brechungsindex) unter Einhaltung des kritischen Winkels vollständig, also durch totale interne Reflexion, zurück in den Kern geführt. Werden zu enge Biegeradien verwendet, wird die Bedingung für totale interne Reflexion verletzt und ein Teil des Lichts in den Mantel oder ins umgebende Medium geleitet – dies führt zu sogenannten Biegeverlusten.
Es gibt unterschiedliche Arten von LWL, welche sich durch die Ausbreitung des Lichts als auch des Durchmessers stark unterscheiden. Damit verbunden sind Eigenschaften wie Dämpfung und maximale Reichweite ohne Signalregeneration. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Fasern:
- Singlemode (Einmodenfaser)
- Multimode (Mehrmodenfaser)
Singlemode
Unter Singlemode-Fasern versteht man Lichtwellenleiter, die so ausgelegt sind, dass sie nur einen einzigen Ausbreitungsmodus (Mode) unterstützen. Sie zeichnen sich durch eine geringe Dämpfung und eine hohe Signaltreue aus.
Eine hohe Signaltreue bedeutet, dass das Signal bei der Übertragung kaum oder in sehr geringem Maße verändert oder gedämpft wird. Dadurch können mit dieser Faserart – vorausgesetzt, es werden geeignete Netzelemente und niedrige Dämpfungswerte pro Abschnitt eingesetzt – Strecken von über 100 km realisiert werden.
Das optische Signal wird senkrecht zur Schnittstelle stark fokussiert in die Faser eingestrahlt. Aufgrund des geringen Kerndurchmessers von 9 µm breitet sich das Licht in nur einem Ausbreitungsmodus aus. Daher rührt der Name dieses Fasertyps.

Prinzip einer Singlemodefaser. Quelle: Technik-Kiste.de
Aufgrund ihres geringen Durchmessers sind Singlemodefasern sehr anfällig gegenüber übermäßiger mechanischer Belastung. Beispiele hierfür sind Quetschungen oder zu geringe Biegeradien. Ihre Einsatzgebiete sind Weitverkehrsnetzwerke (WAN / MAN).
Als Wellenlängen finden im Regelfall die Bereiche 1550 nm (Nanometer) und 1310 nm Anwendung.
Multimode
Die Multimodefaser zeichnet sich dadurch aus, dass sie mehrere Ausbreitungsmoden unterstützt – bedingt durch den größeren Kerndurchmesser und die variierenden Einstrahlwinkel des Lichts.
Achtung! Es handelt sich um keine Form von Mehrfachausnutzung einer Faser! Es wird weiterhin nur ein Signal übertragen.
Aufgrund der regelmäßigen Reflexion werden Signale bei längeren Laufzeiten „unscharf“. Dieser Effekt wird als Modendispersion bezeichnet.
Bei der Reflexion wird zwischen zwei Arten unterschieden:
- Multimode mit Stufenindex
- Multimode mit Gradientenindex
Multimode-Fasern finden vorwiegend im LAN-Bereich Anwendung, da sie bei längeren Distanzen (typisch im MAN-Bereich) aufgrund höherer Dämpfung und Modendispersion weniger geeignet sind. Mit ihnen werden Distanzen von mehreren hundert Metern bis zu 2 km überwunden. Für Multimode-Fasern werden in der Regel 1310 nm und 850 nm als Wellenlänge verwendet.
Im Vergleich zu Singlemodefasern weisen sie ebenfalls andere Durchmesser auf. Der Kern einer Multimodefaser weist meist einen Durchmesser von 50 µm auf und ist umgeben von einem Mantel mit einem Durchmesser von 125 µm.
Stufenindex
Der Name Stufenindex leitet sich von der abrupten stufenförmigen Änderung des Brechungsindexes zwischen Kern und Mantel ab, die zu totaler interner Reflexion führt. Die Eigenschaften dieses Fasertyps sind:
- Geringe Bandbreite
- Mittlere Dämpfung
- Schnell eintretende Modendispersion
Aufgrund des Stufenindex haben die Signale (Moden) verschiedene Laufzeiten. Diese sind abhängig von der "Laufbahn" des Signals. Durch diese Eigenschaft wird heute ein Multimode-Glasfaserkabel mit Stufenindex ungern bei hohen Bandbreiten und Entfernungen eingesetzt.
Wichtig: Stufenindexfasern sind ausschließlich bei älteren Bestandsanlagen vorzufinden und werden nicht mehr neu verbaut.
Multimodefaser mit Stufenindex. Quelle: Technik-Kiste.de
Gradientenindex
Bei Fasern mit Gradientenindex durchlaufen die Signale nicht in Stufen die Faser, sondern in bestimmten Brechungskurven. Der Begriff „Gradientenindex“ bezieht sich auf den kontinuierlichen (gradualen) Verlauf des Brechungsindexes im Kern, wodurch die Lichtstrahlen in sanften, bogenförmigen Bahnen geführt werden.
Multimodefaser mit Gradientenindex. Quelle: Technik-Kiste.de
Im Gegensatz zu Fasern mit Stufenindex besitzen Fasern mit Gradientenindex folgende Eigenschaften:
- Mögliche Bandbreiten > 1 GHz
- Geringere Modendispersion unterhalb 2 km
Aufgrund der "gleichen" bogenförmigen Reflexion der Lichtsignale erreichen (fast) alle zur gleichen Zeit das Ende bzw. die Gegenstelle und bilden so ein klares Ausgangssignal. Diese Eigenschaft bewirkt, dass heute Gradientenindexfasern statt Stufenindexfasern Verwendung finden.
Adern
In LWL-Kabel werden die Fasern in sogenannten Adern geführt. Um möglichst viele Fasern in einem Kabel zu führen, werden daher Bündeladern verwendet. Für diese gilt das sich in einem LWL viele einzelne Fasern befinden.
Neben Bündeladern, bei denen Fasern in Bündel durch kleine Röhren geführt werden, finden ebenfalls andere Aderarten Verwendung:
- Hohlader
- Vollader
Bei einer Hohlader ist die Faser vom umgebenden Gebilde vollständig entkoppelt. Sie liegt frei in einem Hohlraum. Der Vorteil hierbei ist, dass die Zugentlastung besser wirkt, da Beanspruchungen auf das umliegende Gebilde statt auf die einzelne Faser wirkt.
Aufbau einer Hohlader. Quelle: Technik-Kiste.de
Oft werden Hohladern im Bereich von Patch- oder Breakout-Kabel verwendet. Ein Breakout-Kabel ist ein Kabel, bei dem mehrere Fasern in einem Kabelmantel geführt werden. Am Ende sind die einzelnen Fasern mit Steckern und Markierungen versehen.
Bei einer Vollader besteht zwischen den einzelnen Schichten (Coatings) eine feste Verbindung. Sie bilden folglich einen festen Verbund. Einwirkungen auf den äußeren Mantel, wirken sich direkt auf die Faser(n) aus. Auch diese Art wird als Patch- oder Breakout-Kabel eingesetzt.
Aufbau einer Vollader. Quelle: Technik-Kiste.de
Kabeltypen
Es gibt LWL mit unterschiedlichen Eigenschaften für unterschiedliche Verwendungszwecke:
- Innenkabel
- Außenkabel
- Universalkabel
Achtung! Die Verwendungen sind bindend. Ein Innenkabel darf nicht für den Einsatz im Außenbereich eingesetzt werden.
Standards / Normen / Kategorien
Wie bei anderen Übertragungsmedien auch, haben sich bei LWL-Kabeln ebenfalls unterschiedliche Standards und Normen entwickelt und durchgesetzt.
|
Bezeichnung |
Norm |
Quelle |
Faser |
Wellenlänge |
Maximale Entfernung |
|
10Base-FL |
IEEE802.3 |
LED |
Multimode (OM1 – OM4) |
850 nm |
2 km |
|
100Base-FX |
IEEE802.3 |
LED |
Multimode (OM1 – OM4) |
1310 nm |
2 km (ANE*) / 400 m |
|
100Base-SX |
IEEE802.3 |
LED |
Multimode (OM1 – OM4) |
850 nm |
300 m |
|
1000Base-LX |
IEEE802.3 |
Laser |
Multimode (OM1 – OM4) |
1310 nm |
550 m |
|
Singlemode (OS1) |
1310 nm |
2 km |
|||
|
1000Base-SX |
IEEE802.3 |
VCSEL-Laser** |
Multimode (OM2 – OM4) |
850 nm |
500 m |
|
10GBase-LR |
IEEE802.3ae |
Laser |
Singlemode (OS1) |
1310 nm |
10 km |
|
10GBase-SR |
IEEE802.3ae |
VCSEL-Laser** |
Multimode (OM3 – OM4) |
850 nm |
300 m |
|
10GBase-ER |
IEEE802.3ae 2002 |
DFB-Laser |
Singlemode (OS1) |
1550 nm |
40 km |
|
10GBase-LX4 |
IEEE802.3 |
Laser |
Multimode (OM1 – OM4) |
1275 nm 1300 nm 1325 nm 1350 nm |
300 m |
|
Singlemode (OS1) |
1550 nm |
10 km |
|||
|
10GBase-SW |
IEEE802.3ae |
Laser |
Multimode (OM1 – OM4) |
850 nm |
400 m |
|
10GBase-LW |
IEEE802.3ae |
Laser |
Singlemode (OS2) |
1310 nm |
10 km |
|
10GBASE-EW |
IEEE802.3ae |
Laser |
Singlemode (OS2) |
1550 nm |
40 km |
|
10GBase-PR |
IEEE802.3av |
Laser |
Singlemode (OS2) |
1270 nm 1577 nm |
20 km |
* = Aktive Netzelemente (z. B. Switch)
** = Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser
Um den Anforderungen der zuvor genannten IEEE-Standards gerecht zu werden, wurden Faserkategorien international genormt. Diese geben Eigenschaften wie die Dämpfung oder den Kerndurchmesser an.
|
Faserkategorie nach ISO 11801 |
OM1 |
OM2 |
OM3 |
OM4 |
OS1 |
OS2 |
|
Dämpfung bei 850 nm (db/km) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
|
Dämpfung bei 1310 nm (db/km) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1 |
0,4 |
|
Kerndurchmesser |
62,5 µm |
50 µm |
50 µm |
50 µm |
9 µm |
9 µm |
Verbindungstechnik
Wie bei Kupferkabeln unterliegen ebenfalls LWL-Kabel sehr hohen Anforderungen und benötigen Verbindungen und Spleiße. Da LWL-Kabel sehr empfindlich sind, ist eine sehr hohe Präzision bei Arbeiten daran gefordert.
Bei dem Lichtwellenleiter unterscheidet man zwischen einer lösbaren Verbindung (Stecker) und einer nicht lösbaren Verbindung (Spleiß).
Stecker
Bei einem Stecker handelt es sich um eine lösbare Verbindung zwischen aktiven oder passiven Komponenten. Dabei geben die Kopplungen, also Buchsen, die Führung für die Stecker vor. Sowohl bei der Montage des Steckers auf der Faser als auch beim Einbau der Buchse und Einstecken des Steckers in diese ist darauf zu achten, sodass keinerlei Verschmutzungen die optische Übertragung beeinträchtigen und eine möglichst niedrige Einfügedämpfung erreicht wird.
Sollen zwei LWL-Kabel miteinander verbunden werden, also Stecker auf Stecker, so ist eine Kupplung einzusetzen.
 LWL-Kupplung. Quelle: Technik-Kiste.de
LWL-Kupplung. Quelle: Technik-Kiste.de
Innerhalb des Steckers befindet sich die Ferrule. Sie ist ein Führungsröhrchen, welches die Funktion erfüllt, die Fasern genau auszurichten. Wichtig ist, dass die Ferrule eine sehr geringe Einfügedämpfung und eine hohe Rückflussdämpfung aufweist. Nur so können mehrere Übergänge realisiert werden, da ansonsten ein Signal unlesbar werden kann.
Die Endfläche der Ferrule entscheidet zu einem sehr großen Teil über die Übertragungseigenschaften des Steckers. Die Nachbehandlung des Ferrulenende wird Schliff (auch Polieren) genannt. Unterschieden wird zwischen folgenden Arten:
- PC (Physical Contact)
- UPC (Ultra Physical Contact)
- APC (Angled Physical Contact)
Oftmals deuten die Farben der Stecker auf den Schliff hin:
- PC & UPC = Blau
- APC = Grün
 Schliff von Ferrulen. Quelle: Technik-Kiste.de
Schliff von Ferrulen. Quelle: Technik-Kiste.de
Der UPC ist eine Verbesserung des PC und soll das Ansetzen von Schmutz verhindern bzw. einschränken. Seine Signaldämpfung ist geringer und seine Rückflussdämpfung ist höher als beim PC.
Beim APC Stecker ist aufgrund der 8° Schräge die Rückflussdämpfung verbessert, da Reflexionen nicht in den Faserkern, sondern in den Mantel austreten und so die Übertragung nicht stören.
Als Steckersysteme haben sich eine Vielzahl unterschiedlichster Hersteller und Normen durchgesetzt. Sehr häufig anzutreffen sind:
|
Steckertyp |
Einsatz |
Norm |
Einfügedämpfung |
|
E2000 |
MAN / WAN |
IEC 61754-15 |
0,1 dB bis 0,4 dB |
|
ST |
LAN / WAN |
IEC 61754-2 |
0,2 dB bis 0,4 dB |
|
SC |
LAN / WAN |
IEC 61754-4 |
0,2 dB bis 0,3 dB |
|
LC |
LAN / WAN |
IEC 61754-20 |
0,2 dB |
Spleiß
Hierbei handelt es sich um eine nicht lösbare Verbindung zweier Fasern miteinander. Für den Fusionsspleiß (thermische Verschmelzung) wird ein Spleißgerät genutzt. In diesem Gerät erfolgt das Spleißen meist vollautomatisch, da hierfür eine sehr hohe Genauigkeit benötigt wird.
Arbeitsschritte beim Spleißen sind:
- Abisolieren der Faserenden
- Schneiden der Faserenden
- Einlegen der Fasern in das Spleißgerät
- Ausrichten der Faserenden
- Durchführung des Lichtbogenspleißes
- Schutz des Spleißes und der Faser
- Ablegen der Spleiße
Je besser der Spleiß ist, umso geringer ist die hierdurch entstehende Einfügedämpfung.
Unfallverhütung
Bei Arbeiten an LWL-Kabeln können Gefährdungen durch Laserstrahlung auftreten. Daher gilt es, einige grundlegende Regeln zu beachten.
- Beschäftigte dürfen nicht mit ungeschützten Augen oder einem nicht anerkannten optischen Gerät auf Faserenden oder Steckerkontaktflächen blicken
- Faserende nicht auf andere Personen richten
- offene Faserenden – an denen nicht gearbeitet wird – abdecken
- offene Stecker mit Staubschutzkappen versehen
Bei LWL-Kabeln können Gefährdungen mit indirekten Auswirkungen durch Faserreste auftreten. Feine Fasern können in die Haut oder die Augen eindringen und zu Entzündungen führen.
Gefährdungen durch Faserreste:
- bei Reinigungsarbeiten das Aufwirbeln von Glasfaserresten vermeiden
- entstehende Faserreste sollten in gesonderten Behältnissen gesammelt und entsorgt werden
Achtung! Beachte bei der Arbeit unbedingt folgende Punkte:
- LWL-Buchsen abschirmen durch Kappen!
- Arbeitsbereich abgrenzen!
- Laserleistung absenken oder ausschalten!
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen!
- Sauberkeit wahren!